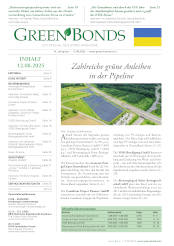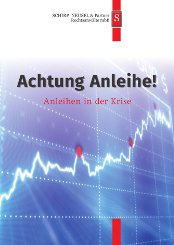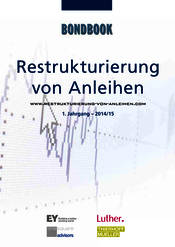Nun ist sie also vorbei – die größte Automesse der Welt. Für viele ist sie mehr als eine Branchenschau. Sie gilt als Barometer für die bedeutendste Industrie Europas, als Seismograf für die wirtschaftliche Verfassung des Standorts Deutschland. Messen sollten Orte der Innovation sein, Räume für Visionen, für Zukunftsentwürfe. Doch in München wirkte es eher, als würde ein ganzes Industriebündnis auf Sicht fahren – und das im Nebel. Während chinesische Hersteller mit beeindruckendem Selbstbewusstsein ihre elektrischen Zukunftspläne ausrollten, suchten viele deutsche Aussteller Schutz in der Vergangenheit. Augen zu, durchhalten, hoffen, dass es die Politik schon irgendwie richten wird. Zurück in die Höhle. Vorwärts nimmer – rückwärts immer?
Die enge Allianz zwischen Politik und Autoindustrie erlebt gerade ihr neuestes Kapitel: Die Debatte um das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 bringt altbekannte Reflexe zurück. CSU-Chef Markus Söder warnt vor einem „wirtschaftlichen Kollaps“ – als würde mit dem Ende des Verbrenners auch gleich der Untergang des Industriestandorts eingeläutet. Zielscheibe dieser Alarmrhetorik ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die zum Autogipfel geladen hat, um über eine Regel zu sprechen, die längst beschlossen ist.
Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen zugelassen werden, die keine CO₂-Emissionen verursachen. Der Verbrenner wäre damit Geschichte – mit einer politisch hart erkämpften Ausnahme: synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels. Für manche ein Hoffnungsträger, für andere ein teures Placebo. Denn realistisch betrachtet sind E-Fuels im Pkw-Bereich ineffizient, teuer und schwer skalierbar. Sie dienen oft mehr dem politischen Gesichtsverlust als einer realen Strategie zur Emissionsreduktion.
Natürlich gibt es technologische Übergangsbereiche – etwa im Schwerlastverkehr oder in der Luftfahrt – in denen Elektromobilität heute noch an ihre Grenzen stößt. Aber die Zukunft des Antriebs im Alltagsverkehr liegt eindeutig im Strom, nicht im synthetischen Hintertürchen.
Die Wahrheit ist unbequem, aber klar: Die europäischen Klimaziele lassen sich nur mit einem tiefgreifenden Technologiewechsel erreichen. Es ist unehrlich, wenn Automanager öffentlich das 1,5-Grad-Ziel bekräftigen, gleichzeitig aber fordern, man dürfe den Verbrenner nicht aufgeben, weil er in vielen Weltregionen weiter gefragt sei. Der Klimawandel fragt nicht nach Märkten oder Handelszonen. Er ist global – und er duldet keine halben Lösungen.
Gerade die beliebten Plug-in-Hybride, in China Verkaufsschlager, entpuppen sich vielfach als ökologische Mogelpackung. In der Praxis wird eben doch häufiger der Verbrenner genutzt als der Elektromotor. Die Folgen sind real: mehr CO₂, weniger Fortschritt, sinkende Glaubwürdigkeit.
Wenn die europäische Autoindustrie glaubt, mit einem „weiter so“ ließe sich Rentabilität sichern, verkennt sie den Ernst der Lage. Es ist nicht fünf vor zwölf – es ist längst zwölf vorbei. Jetzt ist die allerletzte Gelegenheit, der Branche neue Impulse zu geben. Nachhaltige Gewinne werden sich nur erzielen lassen, wenn man kurzfristigen Renditedruck hintenanstellt. Auch Investoren und Aktionäre werden lernen müssen: Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif.
Doch selbst die Unternehmen, die sich zum Wandel bekennen, haben Mühe, ihn umzusetzen. VW etwa verschiebt den Produktionsstart seiner neuen Elektromodelle ID.Roc und ID.Golf auf frühestens 2030. Die Gründe: hoher Kostendruck, schleppende Nachfrage, technische Unsicherheiten. Das hat Folgen: Die Verlagerung des Verbrenner-Golf aus dem Wolfsburger Stammwerk nach Mexiko verzögert sich ebenso wie der ursprünglich für 2027 geplante Produktionsstart des ID.3 in Wolfsburg. Frühestens 2028 wird die größte Autofabrik der Welt elektrisch – ein spätes Signal in einem sehr späten Rennen.
Viele interpretieren solche Verzögerungen als Scheitern der Elektrowende. Doch das greift zu kurz. Der Strukturwandel ist nicht gescheitert – er ist einfach schwieriger als gedacht. Das ist kein Grund zur Resignation, sondern zur Umorientierung. Statt den Wandel ernsthaft zu gestalten, sucht man nun wieder Schuldige: Brüssel, China, die USA. Dabei sind die Ursachen hausgemacht – jahrelange Trägheit, zu späte Kurskorrekturen, zu viel Lobbyismus.
Das Verbrenner-Aus ist kein politischer Schnellschuss, sondern die späte Antwort auf eine lange Geschichte des Verzögerns. Bereits vor über fünf Jahren beschlossen – nicht zuletzt als Reaktion auf den Diesel-Skandal, bei dem Konzerne wie VW systematisch betrogen und manipuliert haben. Die Politik zog daraus Konsequenzen – endlich.
Und trotzdem: Die Zwischenbilanz ist ernüchternd. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Neuzulassungen in Deutschland bei gerade einmal 18Prozent. In vielen anderen EU-Staaten sieht es kaum besser aus. Für die Industrie, die Milliarden in Werke, Software und Batterietechnik investiert hat, ist das enttäuschend. Aber wer jetzt den Rückwärtsgang einlegt, verbrennt mehr als Kapital – er riskiert die technologische Souveränität Europas.
Zumal der Druck von außen wächst. In den USA steht mit Donald Trump ein Präsident in den Startlöchern, der die Klimapolitik radikal zurückdrehen will. In Europa träumen Populisten wie die AfD von einem nationalen Rollback – zurück zu Kohle, Benzin und vermeintlicher Größe. Europa steht vor einer Richtungsentscheidung: Folgen wir den Rattenfängern – oder halten wir Kurs, auch wenn der Gegenwind bläst?
Die Automobilindustrie ist eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft. Sie steht für Wohlstand, Arbeitsplätze, technologischen Fortschritt. Doch ihre Zukunft hängt nicht an politischen Ausnahmen oder geschönten Bilanzen. Sie hängt an der Fähigkeit, sich neu zu erfinden.
Denn wenn die Autoindustrie hustet, liegen viele mittelständische Zulieferer mit Lungenentzündung auf der Intensivstation. Gerade an dieser Stelle braucht es endlich verlässliche Planungssicherheit. Wer nicht weiß, worauf er künftig hin entwickeln, investieren und fertigen soll, kann keine Innovation leisten. Und was technologisch nicht geplant werden kann, wird wirtschaftlich nicht entstehen – mit weitreichenden Folgen bis hinein in den Kapitalmarkt.
Klar ist: Wer morgen noch mitspielen will, muss heute die Richtung ändern. Der Weg in die Zukunft führt nicht über Ausreden, sondern über Entscheidungen. Nicht über Angst, sondern über Mut.
Zu mwb:
Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb gut 51.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.
www.fixed-income.org