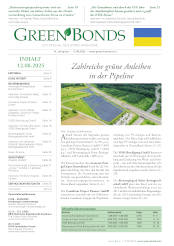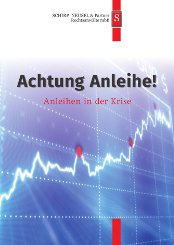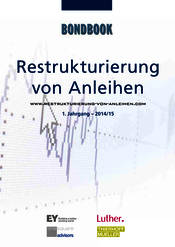Künstliche Intelligenz hat sich auch in der europäischen Wirtschaft zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt – sichtbar in Strategien, Investitionen und Bilanzen. Schon jetzt investieren Unternehmen jedes Jahr Milliardenbeträge in digitale Infrastruktur, Computerchips und Rechenzentren. Von Elektrifizierungs- und Halbleiterunternehmen bis zu Dienstleistern verändert KI ganze Wertschöpfungsketten: Sie steigert Effizienz, treibt Umsätze und Margen, erfordert aber zugleich hohe Investitionen. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel bei Chipherstellern, Automatisierungsanbietern und Rechenzentrumsbetreibern. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen: Für personalintensive Branchen wie Telekommunikation und Kundenservices bedeutet der KI-Schub auch Kostendruck und Anpassungszwang. Deshalb sollten Investoren keine Sektorwetten eingehen, sondern jedes Unternehmen einzeln prüfen.
Bis zum 4. Quartal 2024 wurde KI in Analysten-Calls der Unternehmen des Stoxx Europe 600 ins-gesamt 1788-mal erwähnt – rund 20% häufiger als im Jahr zuvor. Das ist ein deutliches Signal: Aufsichtsräte und Management sehen KI als wichtigen künftigen Ergebnistreiber. Über nahezu alle Branchen hinweg bekennen sich Unternehmen zur Künstlichen Intelligenz. Inzwischen wirkt sich das auch auf die Bilanzen aus: Der Aufbau von KI-Infrastruktur bindet enorme Summen an Kapital – in einer Größenordnung, wie man sie bisher vor allem von Energieversorgern sowie von Öl- und Gasunternehmen kannte. In Europa ist der große Teil der KI-Investitionen derzeit auf eine begrenzte Gruppe von Anbietern beschränkt: vor allem Elektrifizierungszulieferer, Halbleiter-Ausrüster und Anbieter von Rechenzentren. Viele Anwenderunternehmen nutzen KI dagegen hauptsächlich zur Kostensenkung oder befinden sich noch in Pilot- und Rollout-Phasen. Dort ist der konkrete Nutzen oft noch nicht voll in der Bilanz sichtbar. Das gilt auch für viele dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle, die erst einmal Anlaufkosten, Umstrukturierungen und Personalmaßnahmen verkraften müssen, bevor sich Einsparungen und Effekte auf die Profitabilität zeigen.
Chip-Hersteller profitieren unterschiedlich vom KI-Boom
Die Vorstellung, dass alle Chip-Hersteller im selben Ausmaß von KI profitieren, ist falsch: Während US-Anbieter von Grafikprozessoren (GPUs) mit speziellen Beschleunigern sehr hohe Gewinne erzielen, verdienen die großen europäischen Halbleiterunternehmen vor allem an den unverzichtbaren Komponenten drumherum. Sie liefern zum einen die Fertigungsausrüstung für diese Chips und zum anderen die Leistungselektronik, damit der Betrieb im großen Maßstab funktioniert. ASML aus den Niederlanden ist hier das beste Beispiel: Die EUV-Lithografiesysteme des Unternehmens sind zwingend nötig, um modernste KI-Prozessoren zu produzieren. Die KI-Welle führt zu einem kräftigen Bestellschub. Die Buchungen im 3. Quartal 2025 lagen etwa doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal.
Infineon aus Deutschland und STMicroelectronics aus der Schweiz profitieren nicht über hohe GPU-Preise vom KI-Boom, sondern über effiziente Strom- und Steuersysteme. Diese Systeme er-möglichen es Rechenzentren, hohe Lasten sicher zu tragen und ermöglichen gleichzeitig, KI in Autos, Fabriken und Alltagsgeräten einzusetzen. Beide Unternehmen betonen, dass die KI-getriebene Nachfrage die Schwäche klassischer Auto- und Industriezyklen mildert und zu neuen Investitionen führt.
So wachsen Europas Chiphersteller zwar nicht im gleichen Tempo wie Nvidia, aber KI stabilisiert bereits ihre operativen Cashflows. Wir sehen diese Cashflows als nachhaltig an und sie stärken bereits die Ratings der europäischen Chiphersteller.
Preissetzungsmacht im Energiemanagement
Auch europäische Anbieter von Automatisierungs- und Elektrifizierungstechnik berichten, dass der KI-Boom ihre Auftragslage verbessert – und häufig auch die Margen. Die Gründe sind hoch-wertige, gut planbare Auftragsbestände und eine verbesserte Preissetzungsmacht. Siemens brachte die Stimmung bereits im August 2024 auf den Punkt: »KI wirkt wie ein Turbolader für unser Geschäft.« Inzwischen stützt die starke Nachfrage aus Rechenzentren und digitalisierten Industriebranchen große Teile der Wertschöpfungskette von Siemens.
Weil KI auf Strom basiert, führt der Nachfrageboom zu einem stark wachsenden Strombedarf: Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 – vor allem wegen des KI-Booms – mehr als doppelt so hoch sein wird wie heute. Diese Entwicklung verschafft europäischen Anbietern von Anschluss-, Kühl- und Stabilisierungstechnik ei-ne komfortable Position. Sie können ihre Preisforderungen besser durchsetzen und haben sehr gut absehbare künftige Umsätze.
Der Schweizer Industriekonzern ABB rechnet weltweit bis 2030 mit Gesamtinvestitionen in Rechenzentren in Höhe von mehr als 1 Bio. US-Dollar. Die Elektrifizierung von Rechenzentren steht bereits für rund 7% des ABB-Konzernumsatzes von 35 Mrd. US-Dollar und wächst jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Nahezu das gesamte organische Wachstum im 1. Halbjahr 2025 kam aus dem Rechenzentrumsbereich, der inzwischen rund ein Viertel des Konzernumsatzes aus-macht. Gleichzeitig strebt das Management Gewinnmargen auf Konzernebene von über 20% an. Für Anleiheninvestoren bedeutet das: mehrere Jahre relativ gut planbarer Cashflow in einem Segment mit Preissetzungsmacht, gestützt durch finanzierte, vertraglich gebundene Elektrifizierungsprojekte entlang des Ausbaus von KI-Infrastruktur. Deshalb bewerten Ratingagenturen solche Aufträge zunehmend ebenso positiv wie Infrastruktur-Umsätze.
Betreiber von Rechenzentren profitieren zeitverzögert
Wenn der Zugang zu Strom gesichert ist, müssen die physischen Kapazitäten für KI-Modelle geschaffen werden: Rechenzentren und »Souveräne Clouds«. Das erfordert zunächst sehr hohe Investitionen. Der amerikanische Rechenzentrumsbetreiber Equinix, einer der global wichtigsten Vermieter für Rechenlast aus KI-Anwendungen, will seine Kapazität bis 2029 verdoppeln. Dafür sind deutlich höhere Ausgaben für Grundstücke, Netzanschlüsse, Transformatoren, Kühlung und Glasfaser-Verkabelung nötig. Die Aktie verlor am Tag der Ankündigung Ende Juni 2025 knapp 10% an Wert, weil Investoren niedrigere kurzfristige Cashflows eingepreist hatten. Die Ratingagentur Fitch bestätigte das Rating von »BBB+« dennoch. Ausschlaggebend waren mehrjährige Vorvermietungen, ein breiter Mix an globalen Cloud-Großkunden sowie ein gut gesicherter Zu-gang zur Stromversorgung. Lange Phasen negativer freier Cashflows beurteilen Ratingagenturen unter diesen Bedingungen relativ wohlwollend.
Der amerikanische Mitbewerber Digital Realty geht einen ähnlichen Weg. Das Unternehmen investiert Milliardensummen in Hochleistungs-KI-Infrastruktur, die zu einem großen Teil bereits vorvermietet ist. Der durchschnittliche Zeitraum bis zum Start dieser Mietverträge beträgt etwa acht Monate. Bei Vertragsverlängerungen werden die Bestandsmieten um rund 8% angehoben und mehr als die Hälfte der neuen Buchungen steht im Zusammenhang mit KI. In der Folge hob Digital Realty seine Umsatzprognose für 2025 um 3% an. Und bei einer sektorweiten Überprüfung von Rechenzentrumsbetreibern stufte die Ratingagentur Standard & Poor’s Digital Realty Ende Juli von »BBB« auf »BBB+« hoch. Grundlage waren die vertraglich gesicherten Auftragsbestände und Vorvermietungen an etablierte große Cloud-Anbieter.
Unternehmensinterne Automatisierung: KI als Kostenkiller
Große Konzerne nutzen KI derzeit vor allem als Hebel zur Kostensenkung, insbesondere in Personal- und Serviceprozessen. Europäische Telekommunikationsunternehmen liefern dabei besonders anschauliche Beispiele: British Telecommunications (BT) etwa setzt seit Ende 2024 den KI-Assistenten Aimee ein, der bereits bis zu 60.000 Kundenkontakte pro Woche bearbeitet. In einigen Standardfällen wird fast die Hälfte der Anfragen automatisiert abgewickelt. Im Juni 2025 erklärte BT-CEO Allison Kirkby, der Plan, bis 2030 mehr als 40.000 Arbeitsplätze abzubauen und rund 3 Mrd. Pfund an Kosten einzusparen, bilde das volle Potenzial von KI noch gar nicht ab. BT könne »am Ende des Jahrzehnts noch kleiner« sein, also schlanker und stärker automatisiert. KI wird hier zu einem zentralen Baustein des Betriebsmodells: Die Maßnahmen schützen die Margen und stärken die künftige Liquidität. Die Einsparungen solcher Strategien zeigen sich allerdings selten sofort im nächsten oder übernächsten Quartal. Zunächst steigen die Ausgaben – etwa für Abfindungen, Umschulungen, Erneuerung der IT-Landschaft und die Neugestaltung von Prozessen.
Personalintensive Dienstleister unter Druck
Besonders hoch ist der Druck, KI einzusetzen, bei personalintensiven Dienstleistern, die nah am Kunden arbeiten. Dazu zählen ausgelagerte Kundenbetreuung, Überwachung von Website-Inhalten, Beschwerdemanagement und Anbieter von Kundenbindungsprogrammen.
Wenn die erste Bearbeitung von Aufgaben nämlich zunehmend durch Bots erfolgt, sind Auftrag-geber nicht mehr dazu bereit, die Kosten für die Bearbeitung durch Menschen zu zahlen. Das drückt die Preise – etwa bei den Unternehmen Teleperformance und Concentrix. Teleperformance aus Frankreich reagiert mit einer offensiven Strategie und versucht, sich als KI-gestützter Digital-Customer-Experience-Anbieter neu zu positionieren. Im 1. Halbjahr 2025 startete das Unternehmen mehr als 250 KI-Projekte und verpflichtete sich zu KI-Partnerschaften im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Allein in den ersten sechs Monaten investierte Teleperformance rund 30 Mi-o. Euro in Cloud-Abonnements und deren Umsetzung. Die Botschaft an Investoren ist eindeutig: Heute wird viel Geld investiert, damit das Unternehmen morgen nicht wegen zu hoher Preise aus dem Markt gedrängt wird.
Der US-Konzern Concentrix berichtet von einer ähnlichen Entwicklung: Rund 40% der neuen Aufträge basieren bereits auf den unternehmenseigenen KI-Plattformen. Gleichzeitig bleiben die Margen vorübergehend unter den Erwartungen, weil der Aufbau der KI-Projekte zunächst Kosten verursacht und die Auslastung drückt.
Die Branche steht damit vor einer Doppelbelastung: Customer-Experience-Dienstleister müssen ihre Produkte neu bepreisen und gleichzeitig die Neuerfindung ihres Geschäftsmodells finanzieren. Während die Ratingagenturen bei Rechenzentrumsbetreibern wohlwollend urteilen, sehen sie bei Customer-Experience-Dienstleistern erhöhte Risiken für die Bonität. So folgten bei Concentrix Negativ-Ausblicke von Standard & Poor’s und Moody’s – ausdrücklich begründet mit KI-Risiken.
Entscheidend ist die Position in der Wertschöpfungskette
Die Beispiele zeigen, dass Kosten und Erträge sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette ein Unternehmen steht: Am oberen Ende profitieren diejenigen, die physische Engpässe der KI-Infrastruktur lösen – etwa bei Stromversorgung, Kühlung oder Rechenkapazität – und diese Knappheit bepreisen können. Am unteren Ende geraten arbeitsintensive Dienstleister unter Druck, deren Leistungen neu bepreist werden, wenn menschliche Arbeit teilweise durch KI ersetzt wird. Dazwischen gibt es Unternehmen, die massiv investieren, um diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden. Genau diese breite Streuung der Ergebnisse macht KI in Europa zu einem wichtigen Thema für die Anleihenmärkte – und nicht nur zu einer Story für Aktieninvestoren.
Anleihenauswahl mit KI-Fokus bei BANTLEON
KI verschiebt Erträge, Investitionen, Preissetzungsmacht und Verschuldung sehr unterschiedlich – je nach Vertragsstruktur, Zugang zum Stromnetz, Abhängigkeit von Rechenzentren, Bedarf an Mitarbeitern und Bilanzqualität. Deshalb sollten Investoren keine Sektorwetten eingehen. Entscheidend für den Anlageerfolg ist eine sorgfältige, fundamentale Anleihenauswahl, die den Cashflow – und nicht die Schlagzeilen – über die gesamte Wertschöpfungskette verfolgt. Genau dieses Prinzip steht im Zentrum unseres Investmentprozesses bei BANTLEON.
www.fixed-income.org